Geschichten und Enden
Was bisher geschah: Die Lunarcheninquisition
Jace brachte seine Zeit auf Innistrad damit zu, einem Geheimnis hinterherzujagen: angefangen bei Lilianas Haus über das Markov-Anwesen zum Unterwassergrab, dann wieder zurück zu Liliana und von dort schließlich zur Kathedrale von Thraben. Auf dieser Reise war sein einziger Orientierungspunkt ein im Markov-Anwesen gefundenes Tagebuch, bei dem es sich um eine gebundene Sammlung von Forschungsunterlagen handelte.
Und wie es der Zufall will, ist die Verfasserin jener Aufzeichnungen – eine Planeswalkerin namens Tamiyo vom Mondvolk – ihm auf der gleichen Suche mehrere Schritte voraus ...
Ungeachtet der Tatsache, dass ihre Füße den Steinboden nie berührten, dachte Tamiyo dennoch darüber nach, auf Zehenspitzen zu gehen, als sie die Kantorei der Kathedrale von Thraben durchquerte. Auf Dutzenden von Welten hatte sie Hinweise darauf gefunden, wie Zweibeiner – oft in übertriebener Behutsamkeit oder gar in theatralischer Manier – auf Zehenspitzen gingen, um ihre Absicht zu verdeutlichen, sich heimlich fortbewegen zu wollen. Dabei ruhte das Gewicht eines Wesens auf einer kleineren Fläche, wenn es auf Zehenspitzen unterwegs war. Auf Dielen – einem Bodenbelag aus Holz, der auf der Mehrzahl aller Welten, welche sie mit eigenen Augen erblickt hatte, durchaus üblich zu sein schien – erhöhte das Gehen auf Zehenspitzen sogar die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Dielen knarzte, was die bei weitem häufigste Art eines unabsichtlichen Geräuschs darstellte, das die Anwesenheit eines Schleichers auf Zehenspitzen offenbarte. In den meisten Fällen beobachtete sie Ungereimtheiten dieser Art bei Menschen, und es bereitete ihr durchgängig ein gewisses Vergnügen, sie zu dokumentieren. An Innistrad jedoch war nichts Vergnügliches. Die Hinweise deuteten unverhohlen etwas wesentlich tiefer Reichendes und Gefährlicheres als nur bloße Ungereimtheiten an. Sie war bereits länger hier, als sie beabsichtigt hatte. Sie war bereits viel zu viele Risiken eingegangen. Doch diese Welt war vollständig aus den Fugen geraten, und sie musste einfach wissen, warum.
Zahlreiche logische Spuren hatten sich als Sackgassen erwiesen. Manche waren zwar vielversprechend gewesen, hatten jedoch zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. Ihre astronomischen Untersuchungen ließen eigentlich nur einen einzigen Schluss zu, doch die Ursache für all das – der allererste Auslöser – entzog sich ihr noch immer. Dies war ein Buch mit tausend Siegeln, ein Rätsel aus zehntausend Lügen. Sie hatte noch nie zuvor etwas derart Verzwicktes zu lösen versucht.
Sie hatte außerdem auch noch nie aufgegeben, ehe ihre Arbeit nicht getan war.

Ihre neuesten Studien hatten sie zur Kathedrale geführt, wo die Menschen Innistrads die ältesten historischen Aufzeichnungen über Avacyn aufbewahrten. Die Geschichten, die sie bislang gefunden hatte, waren jede für sich genommen rätselhaft und unvollständig, doch sie kannte sich mit den grundlegenden Melodien von Geschichten aus. Sie wusste, an welchen Enden sie ziehen und welchen Spuren sie folgen musste, um – einen schwebenden Schritt nach dem nächsten – der Wahrheit näher zu kommen. Sie rechnete gar nicht damit, das, wonach sie suchte, einfach irgendwo ganz offen in einem alten Buch niedergeschrieben zu entdecken. Sie hatte viele Geschichten wie diese gehört, doch noch nie selbst eine davon erlebt. Dennoch gab es in den ältesten Chroniken für gewöhnlich die wenigsten Verzerrungen, da es in ihnen nur der geringsten Zahl an Schreibern möglich gewesen war, die Worte nach eigenem Gutdünken zu verdrehen. Avacyn. Die Welt war aus den Fugen geraten, und sie war die innerste Stütze Innistrads. Die Metapher passte gut.
Sie flüsterte ein leises Gebet an die Kami. Sie wusste natürlich, dass es hier keine Kami gab: Geister nahmen je nach Welt unterschiedliche Gestalten an, und die Geister Innistrads hatten keinerlei Ähnlichkeit mit den kleinen Göttern ihrer Heimat. Keines ihrer Experimente hatte je Anlass zu der Vermutung gegeben, dass die Kami ihre Gebete über die Weltengrenzen hinaus hören konnten. Doch die bloße Tatsache ihrer örtlichen Nicht-Messbarkeit war keine Entschuldigung dafür, unhöflich zu werden.
Bewaffnete Katharer patrouillierten stoisch und wachsam durch die Hallen und hielten nach Eindringlingen wie ihr Ausschau. Sie hatte bereits mehr Umgang mit der einheimischen Bevölkerung gehabt, als ihr lieb war, und sie stieß an die Grenzen ihrer natürlichen Stille und Verstohlenheit. Um in die inneren Bibliotheken vorzudringen, brauchte sie eine Geschichte – eine, die sie der Welt um sich herum erzählen konnte.
Eine alte Schriftrolle, eine ihrer ersten und liebsten, entrollte sich an ihrer Seite. Es war eine Geschichte aus ihrer Heimat – und genau jene, die sie nun brauchte.
Von dem, der die Sonne das Fürchten lehrt
Dies ist die Geschichte von einer Welt, die im Dunkel versank, und dem, der die Sonne das Fürchten lehrt. Sein Schatten brachte all jenen in seinem Weg die Nacht und sein Hunger war niemals zu stillen. Die Akki wussten sehr wohl, was der Oni vor aller Augen verbarg: die Ausbeute eines ganzen Lebens voller Plünderungen und Raubzüge. Doch niemand wagte es, den Zorn des Oni herauszufordern, außer einer, die keine Furcht kannte.
Als diese Akki nun einen langen, flachen Stein fand, hielt sie ihn sich über den Kopf. Von hoch oben, von wo aus der Oni herabblickte, schien sie nichts weiter zu sein als eben solch ein Stein. Und derart getarnt ging sie zu seiner Höhle, fest überzeugt, dass sie vor einer Entdeckung gefeit war.

Doch der Oni war neugierig.
„Es ist so seltsam, kleiner Stein, wie du dich bewegst! Bist du hier, meine Reichtümer zu stehlen?“
„Ich, o Großer“, erwiderte der Stein, „habe noch nie von einem Stein gehört, der Reichtümer stiehlt. Du etwa? Ich verspreche, ich lasse es dich wissen, falls ich eines Diebs ansichtig werden sollte.“
Der Oni hörte Wahrheit in den Worten der Akki und sah keinen Grund zur Sorge. Er legte sich schlafen, und die Akki schaffte nun so viel aus der Höhle fort, wie sie nur tragen konnte. Gold, Edelsteine und eine glänzende Platte, auf der ihr Spiegelbild sie angrinste.
Am nächsten Tag kehrte die Akki zurück und der Oni wandte sich an den Stein.
„Kleiner Stein, kleiner Stein! Jemand hat meine Schätze gestohlen! Hast du den Dieb gesehen?“
Die Akki erinnerte sich ihres Versprechens und antwortete: „Ja! Ich sah die Diebin! Eine listige kleine Akki! Vielleicht solltest du dich aufmachen, um nach ihr zu suchen, und sie für ihre Heimtücke bestrafen!“
Der Oni nahm den Vorschlag auf und begab sich auf die Suche. Und während er fort war, machte sich die Akki erneut mit noch mehr gestohlenen Schätzen davon.
Hätte sie es doch hier nur gut sein lassen!
Die gierige kleine Akki kam ein drittes Mal mit dem Stein über den Kopf und Gier im Herzen zur Höhle des Oni. Der Oni war blind vor Zorn.
„Kleiner Stein! Es ist schon wieder geschehen! Ich konnte die Diebin nicht finden, doch erneut sind Schätze von mir verschwunden! Ich weiß nicht, was ich tun soll, außer zum Bau der Akki im Westen zu eilen und sie alle zu verschlingen, nur um sicherzugehen, dass ich auch ja die richtige von ihnen erwische!“
Aus Furcht um ihre Heimat und ihre Freunde erwiderte die Akki: „O Großer! Akki sind zäh und bitter und ganz und gar kein Gaumenschmaus! Es ist besser, sie in Frieden zu lassen, und deine Suche nach der Diebin fortzusetzen!“
Auch wenn der Oni nichts von Steinen verstand, so kannte er sich doch bestens mit Lügen aus. Er hob die kleine Akki mitsamt des Steins hoch und verschlang sie mit einem Bissen.
Die Akki erzählen diese Geschichte, um nie zu vergessen, dass die Wahrheit eine bessere Täuschung ist als jede Lüge, die je erzählt wurde.
Die Macht der Geschichte war angerufen, ihr Zauber entfaltete sich und Tamiyo war nicht mehr zu sehen. Jedem, dem sie nun begegnete, würde sie wie etwas erscheinen, was hierhergehörte – ein weiterer Katharer oder eine dekorative Vase. Bis zu jenem Augenblick, in dem sie eine Lüge aussprach oder der Täuschung nicht mehr bedurfte. Es war eine sehr nützliche Geschichte, doch wie immer, wenn sie eine Geschichte einsetzte, bat sie flüsternd um Vergebung dafür, sie auf diese Weise zu benutzen. Geschichten waren heilig, und es fühlte sich für Tamiyo jedes Mal wie ein Frevel an, sie als Werkzeuge zu gebrauchen.
Heute trug sie neunundzwanzig Geschichten bei sich, die drei in eisernen Einbänden – jene, die nie verwendet werden durften – nicht mitgerechnet.
Sie ging – ihre Füße berührten nun den Boden, der recht kalt war – entschlossen an zwei Katharern vorbei, die zackig salutierten. Sie erwiderte die Geste etwas weniger flüssig und alle sahen nur, was sie sehen sollten. Die Hauptbibliothek war gleich vor ihr. Sie begann, im Geiste die Geschichten durchzugehen, die sie mitgebracht hatte, da sie herausfinden wollte, wie sie wohl am besten die Schlösser knackte, die mit Sicherheit ihr nächstes Hindernis darstellen würden, als sie etwas Eigenartiges bemerkte. Die Tür war bereits einen Spalt geöffnet und dahinter flackerte Kerzenschein.
Sie vollführte eine Geste und eine leichte Brise stieß die schwere Tür ein Stückchen weiter auf. Sie nahm eine leicht geduckte Haltung an, und ihre Füße ruhten nun vollständig auf dem Stein – obwohl sie aus unerfindlichen Gründen noch immerdarüber nachdachte, auf Zehenspitzen zu gehen. Sie schlich auf die Tür zu, bereit, die Beine in die Hand zu nehmen oder anzugreifen.
Die gut geölten Scharniere glitten weiter auf, als Tamiyo ein unverwechselbares Geräusch hörte. Einen Wimpernschlag später erhielten ihre Augen die Bestätigung: Ein schlaffer Leib sackte zu Boden, als wäre sein Besitzer unvermittelt eingeschlafen. Ein Bibliothekar. Ältlich, unbewaffnet und ungerüstet. Und über ihm stand ... ein Planeswalker.

Sie nahm so viele Informationen in sich auf, wie sie nur konnte, bevor die endgültige Entscheidung anstand, ob sie kämpfen oder fliehen wollte. Begegnungen mit Planeswalkern mussten bei ihrer Arbeit vermieden werden, und zwar beinahe um jeden Preis. Sie waren aufdringlich und unberechenbar und konnten die Einflüsse einer jeden unbekannten Welt oder deren Denkweisen in sich tragen. Kurz gesagt: Sie waren eine Gefahr für jeden Wahrheitssucher. Dieser hier schien ein Mensch zu sein, jung und männlich, doch der Hauch von Mana um ihn herum roch nach Täuschung. Er hatte sich die Kleidung der Einheimischen besorgt, doch diese mit Siegeln und Zeichen verziert, die eindeutig nicht von Innistrad stammten – eine merkwürdig einfallslose Verkleidung. Seine Augen leuchteten. Panisch, wild, womöglich krank – ein Gedanke, den sie noch gar nicht bedacht hatte: Wenn ein Planeswalker vom Wahnsinn dieser Welt befallen war, konnte er ihn dann in andere Welten einschleppen? In seinen Händen hielt er ... ihre Forschungsaufzeichnungen. Eine weitere Verwicklung. Sie wartete zwei weitere Wimpernschläge und beschloss, ihn den ersten Schritt machen zu lassen, obwohl sich bereits eine Schriftrolle von ihrem Gürtel gelöst hatte und sich zu entrollen begann.
Sein Blick war verwirrt. Wütend, verängstigt, neugierig – bis sich schließlich so etwas wie Erleichterung und Verständnis in ihn hineinschlichen.
„Du! Du bst es! Du hast mich hierhergeführt! Nein, nicht du, diese ... Diese Aufzeichnungen. Deine Aufzeichnungen! Hast du mich hergeführt, um mich zu treffen? Nein. Wie solltest du auch?“ Sein Blick schweifte wieder in die Ferne und dann zum Boden hinunter, bevor er plötzlich zu ihr zurückhuschte. Vorwurfsvoll. „Du hast mich beobachtet? Du wusstest es!“ Dann wurde er wieder weich, traurig, flehend. „Hilf mir. Kannst du das? Ich glaube ... Kannst du mir helfen? Hilf mir.“ Die letzten Worte waren keinesfalls ein Flehen. Ein Befehl – überwältigend mächtig – zerrte an ihrem Bewusstsein wie der Wind an den Fensterläden. Doch ihr Bewusstsein zog sich in eine weit entfernte Feste zurück, wo der Wind sie nicht erreichen konnte. Vier weitere Wimpernschläge, um nachzudenken, und dann lächelte sie so friedfertig, wie es ihr unter diesen Umständen gelingen wollte. Mit einem raschen Gedanken holte sie den Planeswalker mit in ihren Verschleierungszauber und beförderte eine andere Schriftrolle aus ihrer Tasche zutage. Sie schlüpfte in die Bibliothek und schloss leise die Tür hinter sich. Sie hatte diese Geschichte noch nie auf diese Weise eingesetzt, doch ein wahnsinniger, weltenwandernder Telepath war eine Gefahr, die ihr bislang unvorstellbar erschienen war. Sie hatte diese Geschichte vor vielen, vielen Jahren auf einer Welt mit fünf Monden gefunden, auf der überall Metall schimmerte, so weit das Auge reichte.
Original
Nun da ihr Schöpfer nicht mehr war, waren jene Kreaturen, die man die Myr nannte, verloren.
Manche folgten jenen Anweisungen, die man ihnen zuletzt erteilt hatte, und wiederholten ihre Aufgaben ohne Führung oder Zweck, während andere sich einfach abschalteten, um auf weitere Befehle zu warten, die niemals kommen sollten. Der Verlust Memnarchs tötete sie nicht, doch ohne ein echtes Bewusstsein in ihrer Mitte war ihr weiteres Dasein kaum wirklich als Leben zu bezeichnen.
Einigen Myr war aufgetragen worden, die Bevölkerung der Myr zu überwachen und neue Myr zu erschaffen, um jene zu ersetzen, die beschädigt oder zerstört wurden. Einer von ihnen hatte viele Monate lang geruht, ehe seine Anweisungen ihm zu handeln befahlen. Es gab zu wenige Myr seiner Art und er musste einen neuen erschaffen.
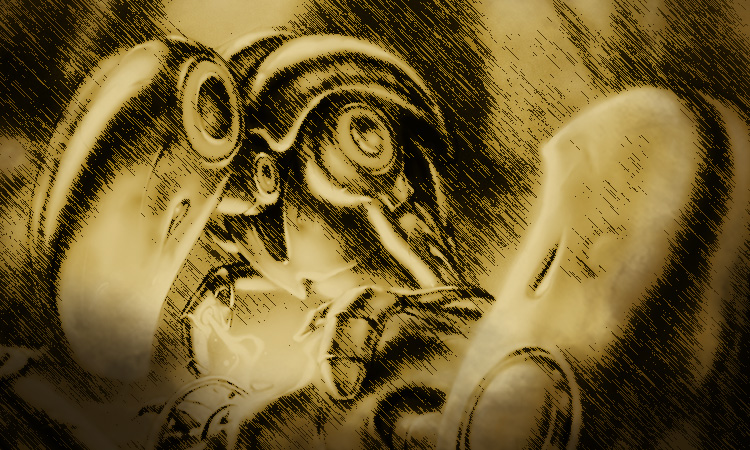
Ohne seinen Schöpfer hatte er jedoch keine klaren Anweisungen, wie er dabei verfahren sollte. Er tat das, worauf er sich verstand: Er sammelte die passenden Materialien, brachte sie in die Werkstatt – einen kleinen, kuppelartigen Raum – und baute einen Myr zusammen, der ihm vollkommen glich.
Dies war der Punkt in jenem Vorgang, an dem der Meister dem neuen Myr Leben und Bewusstsein schenkte. Doch der Meister war nicht hier. Seine Anweisungen bestanden indes fort. Der Myr beschloss, sein eigenes Bewusstsein als Vorlage zu verwenden und einen Abzug seiner selbst in dem neuen Myr zu verankern. So erschuf er ein Wesen, das ihm in jeder Hinsicht glich. Nun da er seine Anweisungen ausgeführt hatte, wollte er die Werkstatt verlassen ... doch sein Ebenbild versperrte ihm den Weg.
Der Myr versuchte, seinem Ebenbild den Vortritt zu lassen, doch dieses hatte zur gleichen Zeit den gleichen Gedanken. Sie warteten eine gleich lange Zeitspanne ab und versuchten es erneut, nur um ein weiteres Mal zusammenzustoßen. Der Myr und sein Ebenbild taten alles, um diese schier unmögliche Symmetrie zu durchbrechen, doch nichts funktionierte. Schließlich vernichteten sie einander aus Verdruss gegenseitig.
Einige Zeit später traf ein dritter Myr ein. Er war mit Reparaturen beauftragt und setzte einen der Myr wieder instand. Dieser hielt den Reparaturmyr auf, ehe er das Ebenbild zum Laufen bringen und das gesamte Problem von vorn beginnen lassen konnte. Stattdessen beschloss er, etwas anderes auszuprobieren. Er schuf einen weiteren Abzug seines Bewusstseins, ließ ihn dieses Mal jedoch unvollständig.
Der neu erwachte Myr war in der Lage, andere auf die gleiche Weise zu erschaffen, und diese neuen Myr, die mit teilweise ungeformten Bewusstseinen erschaffen worden waren, konnten sich vermehren und Änderungen an sich vornehmen und unabhängig voneinander handeln, wodurch sie schließlich jene unzähligen Gestalten annehmen konnten, die sie heute besitzen.
Die Myr feiern diese Geschichte als ihren Schöpfungsmythos, doch der Grund, weshalb sie dies tun, lässt Fragen offen. Es gibt drei Theorien, welcher der Myr in der Geschichte tatsächlich der erste Myr seiner Art war. War derjenige der erste Myr, der einen neuen Myr ohne die Anweisungen seines Schöpfers erschaffen hatte? Hatte der Reparaturmyr in Wahrheit zuerst den neu erschaffenen Myr instand gesetzt und war es daher dieser zweite Myr, der den entscheidenden Schritt hin zur Erschaffung ihres Volkes gemacht hatte? Oder war jener Myr mit dem unvollständigen Bewusstsein der wahrhaftig erste ihrer Art? Die Myr sind sich in diesem Punkt uneins, und sie feiern genau diese Uneinigkeit – die Tatsache, dass sie in einer solch fundamentalen Frage uneins sein und dennoch in Einklang miteinander leben können, bildet den Kern dessen, was es bedeutet, ein Myr zu sein.
Die Augen des jungen Menschen schlossen sich, und er tat mehrere tiefe, lange Atemzüge. Als sich seine Augen wieder öffneten, war sein Blick ruhig.
„Ich danke dir. Hui. Ich ... Oh. Herrje. Liliana ...“ Er rieb sich den Kopf, als wäre er verprügelt worden, und blickte dann treuherzig zu ihr auf. „Ich bin Jace. Und du bist Tamiyo, nicht wahr? Deine Aufzeichnungen ...“
Er hielt ihr das Buch mit beiden Händen hin. Sie hob eine schlanke Hand, eine Geste höflicher Zurückweisung.
„Sie haben mich hierhergeführt. Deine Berechnungen, deine Studien, der Mond – das alles ergab Sinn ... oder zumindest fühlte es sich so an. Ich war krank, und du ... Du hast mich geheilt. Irgendwie. Oh, ich plappere schon wieder sinnlos vor mich hin. Ich klinge wahrscheinlich genauso wirr wie zuvor. Ich ... Ich will dir einfach nur danken.“
Tamiyo lächelte gelassen. „Meine Aufzeichnungen. Ich habe sie jemand Vertrauenswürdigem gegeben, und nun hast du sie. Hast du Jenrik ein Leid zugefügt, Jace?“
Der Mensch schüttelte den Kopf. „Nein. Doch was auch immer im Markov-Anwesen geschehen ist: Er hat es nicht überlebt.“
Sie verbrachte einen Augenblick in stiller Erinnerung, zeigte jedoch keine Trauer auf ihrem Gesicht. „Du musst gehen, Jace. Dieser Ort ist gefährlich, umso mehr für jemanden wie dich. Deine telepathischen Kräfte bringen Verantwortung mit sich. Wenn du dem Wahnsinn verfällst, könntest du unermesslichen Schaden über die Welten bringen, und es wäre unverantwortlich von mir, das zuzulassen.“
„Ja, das verstehe ich, aber ...“ Jace hielt plötzlich inne. Er hatte einen Augenblick gebraucht, um zu begreifen, dass sie ihm gerade gedroht hatte. Er hob die Hände und machte einen Schritt zurück.
„Tamiyo, ich möchte nur helfen. Wir können diesen Ort retten. Ich und meine Freunde, wir können dir helfen, herauszufinden, was hier vor sich geht, und wir können dir helfen, etwas dagegen zu tun. Das wäre nicht das erste Mal für uns ... wenn man so will.“
Tamiyo hob eine weiße Augenbraue und sagte nichts.
„Hör mal, wir beide wissen, dass Avacyn im Mittelpunkt dessen steht, was hier geschieht. Und sie hat ein Bewusstsein, so wie jedes andere Wesen auch. Das heißt, ich kann herausfinden, was sie befallen hat. Ich kann sie aufhalten, falls es nötig ist. Und dann können wir den nächsten Schritt angehen, diese Sache in Ordnung zu bringen.“

Tamiyos Lächeln verschwand.
„Du weißt gar nichts, Jace. Du vermutest Dinge. Du hast eine Theorie. Du hast Hinweise, doch sie sind weit davon entfernt, schlüssig zu sein. Wie viel weißt du tatsächlich über Avacyn? Über ihre Aufgabe? Du hast keine Ahnung, was geschieht, wenn Avacyn vernichtet wird. Sie beschützt diese gesamte Welt – hast du je von einem an eine Welt gebundenen Wesen gehört, das auf eine solche Weise mit dem Multiversum in Wechselwirkung steht? Ich sage es dir geradeheraus, Jace: Du weißt weniger, als du je begreifen wirst, und ich bin nicht hier, um die Gefahr, in der diese Welt schwebt, zu beenden. Ich bin hier, um sie zu verstehen. Um sie aufzuzeichnen. Um die Wahrheit darüber zu erfahren und diese Wahrheit für alle Zeiten festzuhalten. Doch diese Welt ist sehr wahrscheinlich dem Untergang geweiht, und ich habe nicht die Absicht, ihn aufzuhalten. Es ist gewiss traurig, etwas Schönes zu verlieren, aber wie die Blüten eines Hains im Frühling ist diese Schönheit vergänglich. Sie ist nur eine Welt unter zahllosen anderen. Welten werden stets sterben und neu geboren werden. Deine grundsätzlichen Annahmen weisen große Fehler auf.“
Jace zuckte zusammen, als hätte er eine Ohrfeige erhalten. „Aber die Menschen hier – es sind Millionen! Willst du die einfach ihrem Schicksal überlassen? Dem Wahnsinn und Schlimmerem? Wir haben die Macht, hier etwas zu bewirken. Du hast diese Macht. Wirst du mir helfen?“
Tamiyos Miene blieb unverändert, doch ihre Stimme klang etwas eisiger. „Ich habe dir geholfen, Jace. Ich werde dir einen Kompromiss anbieten. Ich teile meine Forschungsergebnisse mit dir und du und deine Freunde können sie dazu verwenden, ähnliche Katastrophen auf anderen Welten zu verhindern, wenn ihr es denn so wollt. Doch ich habe schon zehntausend Geschichten über Helden gesammelt, und ein Held ist nicht mehr als eine Katastrophe mit einem festen Standpunkt.“
Der junge Mensch blieb beharrlich. „Ohne schlüssige Einsichten aus Avacyns Mund wird deine Forschung unvollständig sein. Ohne klares Ergebnis. Mit meiner Hilfe kannst du die gesamte Geschichte enträtseln. Und wenn es mir gelingt, Avacyn im Zuge dessen aufzuhalten, dann würde das deine Arbeit nicht stören und dabei auch noch unzählige Leben retten.“
Neugier. Nur ein leiser Anflug. „Ein eindeutiges Verständnis von Avacyns derzeitigem Zustand wäre zweifellos hilfreich, doch ich vermute, selbst wenn du imstande wärst, in ein so fremdartiges Bewusstsein vorzudringen, würdest du ...“
„Ich kann es schaffen.“
Tamiyo fand die Überheblichkeit des Menschen zu gleichen Teilen ebenso bezaubernd wie irritierend. „Wenn du es versuchst, wird ihr Wahnsinn dich verzehren, wie er dich bereits schon einmal verzehrt hat. Aber ... in der Theorie ... könnte ich dir als Anker dienen. Um dich an deine geistige Gesundheit zu binden. Falls ich jedoch entscheide, dass wir in zu großer Gefahr sind, wirst du die Verbindung sofort abbrechen und wir ziehen uns zurück. Es erfordert zudem, dass wir unser beider Bewusstseine auf einer sehr fundamentalen Ebene miteinander verknüpfen. Ich werde dich begreifen und du wirst mich begreifen. Und falls mir nicht gefällt, was ich da begreife, werde ich die Bedingungen dieser Übereinkunft erneut ändern. Du hingegen wirst dann sehr genau erfahren, wozu ich fähig bin. Ist das für dich akzeptabel?“
Jace spürte so etwas wie ein Windspiel in seinem Bewusstsein erklingen. Ein Geräusch, das klar, friedlich und rein war.
Es war eine Einladung.
Binnen eines Wimpernschlags kannte sie ihn. Doch es war kein Leichtes, diesen Menschen zu kennen. Sein Geist war mächtig, aber gebrochen. In tausend Splitter zerschlagen – jeder von ihnen ein anderer Mann, von denen zahlreiche versuchten, miteinander auszukommen. Andere hingegen ...

Er hatte seine eigenen Erinnerungen ausgelöscht. Er hatte seine eigene Wahrheit zerstört. Er war in das Bewusstsein Unschuldiger eingedrungen, hatte im Zorn getötet und seine Macht für nichtige und eigennützige Zwecke eingesetzt.
Und doch ...
Er war zu Opfern, zu Kühnheit und zu Verständnis fähig. Er war gewillt, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht sogar zu viel Verantwortung für jemanden, der noch so jung war. Noch jünger gar, wenn man die Jahre seines Lebens mit einbezog, die er derart grob ausgelöscht hatte. Sein Streben nach Wahrheit war aufrichtig, und sein Wunsch, den Menschen dieser Welt zu helfen, rein.
Und er war sich zu etwa drei Vierteln sicher, dass er zu dem imstande war, was er ihr zu tun vorgeschlagen hatte.
Binnen eines Wimpernschlags kannte er sie. Doch kennen hieß nicht verstehen. Jace hatte die Soratima von Kamigawa stets hoch dafür geachtet, wie streng sie ihren mächtigen Verstand disziplinierten. Er sah Tamiyos Leben vor sich, und der Gegensatz zu seinem eigenen bereitete ihm körperliches Unbehagen. Dort, wo er rastlos war, war sie durch Familie, Brauchtum und Heimat sicher verankert.
Heimat. Eine endlose Bibliothek hoch oben in den Wolken. Ein Ort, den sie mehr als alles andere liebte. Das Lächeln und die süße Vertrautheit ihrer Familie. Kinder. Die Orte, an die Tamiyo ging, wenn sie diese Kinder verließ, waren ihnen unbegreiflich, doch ihre Gesichter strahlten so hell, wenn Tamiyo ihnen Geschichten von dort mitbrachte. Unglaubliche Erzählungen, in der Stimme der Wahrheit kundgetan – von Orten, die sie selbst nie zu sehen bekommen würden.
Er sah ihre Last. Die schreckliche Last, zu wissen, und den Drang, Wahrheiten zu beschützen, die zu gefährlich waren, um sie auszusprechen, und doch zu wichtig, um in Vergessenheit geraten zu dürfen. Drei in Eisen gebundene Schriftrollen, jede von einer solchen Macht, dass ...
Jace.
Ihre Verknüpfung durchlief einen Wandel, und die beiden Planeswalker richteten ihre Bewusstseine wieder auf die Welt aus, auf der sie sich gerade befanden.
„Jace, mein Verschleierungszauber wurde durchdrungen. Und eine mächtige Präsenz ist auf dem Weg hierher.“
Der Mensch nickte, und die beiden Planeswalker eilten einen Gang hinunter in die große Kapelle der Kathedrale.
„Ich werde versuchen, mit Avacyn Zwiesprache zu halten. Sie abzulenken. Auf nachdrücklichem Wege, wenn es sein muss. Du wirst nicht viel Zeit haben, sie aufzuhalten, ehe sie uns beide tötet.“
Jace öffnete den Mund zu einer Erwiderung, doch dann wurde die Welt zu einer Sinfonie aus heulendem Wind und zersplitterndem Glas.
Der Engel schwebte vor ihnen. Die gewaltigen Schwingen waren von frischem Blut bedeckt, der Speer glühend heiß und gleißend. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht kündete von zurückhaltender Belustigung. Tamiyo schwebte zu ihr hinauf, um ihr in die Augen zu schauen. Die Schwingen des Engels fachten einen Sturm an; der Aufstieg der Mondfrau vollzog sich ohne das leiseste Wispern einer sachten Brise.

„Avacyn. Ich bin eine Besucherin in deiner Welt, und ich habe mich redlich bemüht, ein höflicher Gast zu sein. Ich wünsche mir nichts weiter als Frieden und Wohlergehen für jene, die du beschützt. Als Engel erkennst du die Wahrheit in meinen Worten. Wie lautet deine Antwort?“
Das Gesicht des Engels verzerrte sich zum erbärmlichsten Spottbild eines Lächelns, das Tamiyo je gesehen hatte, und ein keckerndes Geräusch drang zwischen den reglosen Lippen hervor. Avacyns Stimme war ein schmerzhaftes Kratzen, das an Insekten und Fingernägel erinnerte.
„Wie ... meine Antwort lautet? Ich existiere ... um andere zu schützen. Vor dir. Eindringling. Invasorin. Fäulnistreiberin. Unrein! /UNREIN!“
„Ich verstehe“, erwiderte Tamiyo und entrollte eine zuvor bereit gemachte Schriftrolle. „Das ist bedauerlich.“
Sie musste nicht mehr tun, als einen flüchtigen Blick auf die Worte auf der Schriftrolle zu werfen. Es war eine Klage, ein Lied von einer uralten Welt, wo Kälte und Eis ebenso gefährlich waren wie jede Bestie. Ein Lied von Verlust und Reue. Sie kannte jede Zeile auswendig.
Das Heulen des Winters
Ein junger Mann trat durch des Berges Tür.
Ein kurzer Weg, nur rasch zu Hof und Zaun.
Des Winters Kälte unter schwerem Schnee
Gefror ihn schnell, nie wieder sollt‘ er tau‘n.

Sein liebes Weib, so jung und schön wie er,
Tat ihr Werk von schlimmer Wahrheit frei:
Das Blut ihres Liebsten gefroren sei.
Da packt sie die Ahnung von Witwenschwarz!
Voller Schrecken schallt nun vom Berg ihr Ruf.
Von der See her steigt nackte Kälte auf.
Von den Hängen hallt der Schrei, den sein Schmerz schuf.
Avacyn stürzte sich mit einem Schlag ihrer gewaltigen Schwingen vorwärts und Tamiyo glitt durch die Luft, um gerade noch aus der Reichweite des brennenden Speers des Engels zu entkommen. Als Avacyn im Dachgestühl der Kathedrale herumfuhr, entfesselte Tamiyo bestens gezielte, eisige Böen. Ein paar Federn gefroren und zersprangen, weiß und rot, und rieselten wie Schnee auf den Steinboden herab.
Der Engel schnellte durch die Luft und holte in einem weiten Bogen mit dem Speer aus. Tamiyo glitt vorwärts, um den Angriff zu ködern, und taumelte dann in die entgegengesetzte Richtung, während weitere Eisstürme sie von der Speerspitze fortstießen. Sie zielte auf das rechte Handgelenk des Engels und dann auf das Gelenk der linken Schwinge. Als Tamiyo erneut hinter Avacyn vorbeiglitt, gab sie einen Windstoß auf jenen Punkt ab, wo der Flügel aus der Schulter spross. Avacyn war schnell, und ein einzelner Schlag ihres Speers hätte wohl Tamiyos Ende bedeutet, doch der Engel kämpfte wutentbrannt, wohingegen die Soratami sich mit kühler Berechnung bewegte – Avacyns Gesicht zeigte keine Spur von Schmerz oder Verbitterung, doch ihre Wendigkeit ließ nach. Sie wurde langsamer, und die Kathedrale hallte von jenem unsäglichen Gelächter wider – dem klappernden Rasseln trockener Knochen und dem Schaben tausender Rattenkrallen.
Tamiyo sandte einen eiligen Gedanken zu Jace, der unten verborgen war.
Sie passt sich an. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Avacyn hob den Speer, und einen Augenblick lang erkannte Tamiyo in ihr die Beschützerin aus den Geschichten – jenen Engel, der den Menschen Innistrads wie ein Leuchtfeuer gewesen war. Ein gleißendes Licht umgab sie und erhellte jeden Winkel der Kathedrale. Tamiyo prallte vor seiner Macht zurück. Das Licht brannte heller, drang wie eine körperliche Urgewalt auf die beiden Planeswalker ein und zwang Tamiyo zurück zu Boden und Jace auf die Knie. Gemächlich sank der Engel herab, den Speer auf Tamiyos Brust gerichtet und all die Wut mit einem Mal verschwunden – Avacyn war das pure Ebenbild tödlicher Anmut.
Beinahe hatte sie ihr Ziel erreicht ...
Und dann erstarrte sie. Das Licht erlosch nicht, doch ihre Bewegungen hatten aufgehört. Sie stand nur wenige Schritte von Tamiyos steifer Gestalt entfernt, den Speer nach vorn gestreckt ... und dort blieb sie. Kein Atem, kein Rascheln von Gefieder. Völlige Reglosigkeit. Doch das lähmende Licht drang noch immer auf sie ein.
„Es ist getan, Tamiyo. Sie, nun, sie schläft nicht wirklich, doch das ist das, was dem am nächsten kommt.“
„Jace, vielleicht ist es deiner Aufmerksamkeit entgangen, aber ...“
„Ich arbeite daran. Aber hör mir zu. Sie ist die Quelle des Wahnsinns der Engel. Sie bringen sich irgendwie in Einklang mit ihr. Und durch sie gilt das auch für die Kirche. Aber ... sie ist nicht der eigentliche Ursprung. Sie wird von etwas anderem beeinflusst, und – du hattest recht! Sie hält noch irgendetwas anderes zurück. Ich kann es noch nicht sehen, aber ich glaube, ich kann noch etwas tiefer vordringen ...“
„Jace, das reicht.“
„Warte. Nein. Das ist ...“
Die Luft füllte sich mit dem Geruch von Aas. Avacyns Licht wurde nicht schwächer, doch die Anmut von Glorie verschwand daraus: Das Licht war kalt, übelerregend, klebrig und grausam. Tamiyo schien vergessen. Der Engel wandte sich zu Jace und ging entschlossen zu seiner zusammengekauerten Gestalt hinüber.
„Schänder“, flüsterte sie mit einer Stimme wie in lodernden Flammen zu Asche zerfallender Haut. „Dieb. Eitergeschwür der Verderbtheit.“ Sie fasste hinunter und legte ihm Hand auf die Brust. Alles, was sie ihm womöglich sonst noch zuflüsterte, wurde von seinen Schreien übertönt.

Tamiyo konzentrierte sich auf das Band zwischen ihnen und versuchte, ihm Trost zu spenden und seine Schmerzen zu lindern, bevor das Ende kam. Ganze Schichten seines Bewusstseins waren bereits abgeschabt und im qualvollen Griff des Engels zu jämmerlichem Elend zerronnen. Doch sein Bewusstsein bestand aus vielen Schichten und war gut geschützt. Der Schmerz hatte seine tiefsten Gedanken noch nicht erreicht.
Tamiyo. Die Schriftrolle. Die eiserne Schriftrolle. Du hast sie mir gezeigt. Eine alte Geschichte. Eine mächtige Geschichte. Die Überlebenden eines Ortes, der verloren war ... Serras Reich. Der Kataklysmus, die Macht ... Die Geschichte passt. Das weißt du. Du kannst das hier aufhalten.
Selbst als sie seine Todesqualen spürte, selbst als sie spürte, wie er zu sterben begann, selbst in dem Wissen, dass sie die Nächste sein würde, zögerte sie nicht mit ihrer Erwiderung.
Und dann? Sie beschützt noch immer diese Welt, Jace, trotz ihres Wahnsinns. Hast du je ein Versprechen gegeben, Jace? Ich gab eines, vor langer Zeit. Und Versprechen sind nicht nur dazu da, dass man sie hält, wenn es leicht ist. Wir geben Versprechen für Zeiten wie diese, wenn wir sie am liebsten unbedingt brechen wollen. Nein, Jace. Die Schriftrolle bleibt verschlossen.
Ungläubigkeit. Wut.
Es tut mir leid, Jace. Manchmal müssen unsere Geschichten ein Ende finden.
Schatten über Innistrad-Storyarchiv

